1996 konnte ich für 3 Monate im Yellowstone-Nationalpark arbeiten, inmitten von Grizzly-Bären und Geysiren, Bisons und Bergen, Wapiti-Hirschen und Wasserfällen. Für mich war das eine absolut magische Zeit. Mit diesem Artikel erhältst du ein riesiges Geschenk: Den Bausatz für eine magische Zeit, die du jederzeit erleben kannst, auch ganz ohne Grizzlys und Geysiren.
Arbeiten im Yellowstone-Nationalpark
25. Juli 1996, sechs Uhr morgens. Nach einer nahezu schlaflosen Fahrt steige ich todmüde in Livingstone, Montana, aus dem Greyhound.
Ein Grüppchen Menschen hängt dort rum. Die meisten sind genauso müde wie ich. Einige schlafen. Wir alle warten auf den Shuttle-Bus, der uns in den Yellowstone-Nationalpark bringen soll, wo wir einige Monate arbeiten. Anderthalb Stunden später biegt er endlich um die Ecke.
Irgendwo hält der Shuttle bei einem alleinstehenden Gebäude. Gut gelaunte Menschen stellen uns allerlei Fragen, knipsen ein Porträt-Foto für den Personalausweis und messen meine Grösse für die Uniform.
Dann erfahre ich, wo im Nationalpark ich arbeiten werde: In Mammoth Hot Springs als Kitchen Help. Ein Angestellter sagt, da hätte ich Glück gehabt, Mammoth Hot Springs sei sein favorisierter Ort im Yellowstone. Ob er das allen sagt?
Nach einer gefühlten Ewigkeit fährt der Shuttle weiter nach Süden, überquert die Grenzen zum Nationalpark und bringt uns zur ersten Ortschaft: Mammoth Hot Springs. Dort gibt es eine Informationsveranstaltung, wichtige Hinweise zum Umgang mit den Wildtieren, von denen ich kaum etwas mitbekomme – zu müde bin ich.

Wapiti-Hirsche wärmen sich am frühen Morgen auf den Sinterterrassen bei Mammoth Hot Springs.

Blick von den Sinterterrassen, mit Mammoth Hot Springs im Hintergrund (2008).
Der Shuttle-Bus fährt weiter, bringt die neuen Mitarbeitenden an ihre Arbeitsorte weiter im Süden. Doch ohne mich, ich bin bereits angekommen.
Ich schleppe mein Gepäck in jenes Zimmer im Juniper-Dorm, das mir zugewiesen worden war und das ich gemeinsam mit zwei anderen jungen Männern bewohne, einem Tschechen, der Cabins der Touristen putzt, und einem Franzosen, der am Grill (Fast Food) arbeitet.
Magische Zeit inmitten wilder Natur
Gleich am nächsten Tag gings los: Frühschicht als Tellerwäscher. Alles war neu, alles aufregend. Gemeinsam mit zwei- oder dreihundert jungen und älteren Menschen wohnte ich inmitten wilder Natur. Internet gab es damals noch nicht wirklich, stattdessen schritt ich gelegentlich hinüber zur Poststation.
In meiner Freizeit erkundete ich den Park, entweder zu Fuss oder per Autostopp. Andere Möglichkeiten: Fehlanzeige. Unweit entdeckte ich einen Wanderweg, der mich nach einem vielleicht 45-minütigen Marsch zu idyllischen Biberteichen führte. Oft sass ich dort, auf einem Felsbrocken, und beobachtete, ob irgendwo ein Grizzly- oder Schwarzbär auftauchte.

Beaver Ponds in der Nähe von Mammoth Hot Springs.
Wandern fühlte sich aufregender an als in der Schweiz, denn es gab nebst Bären auch Pumas, Wölfe, Bisons, Elche, Kojoten und etliches mehr. Meistens sah ich aber eher Streifenhörnchen oder Wapiti-Hirsche.
Hach, ich könnte noch lange erzählen... Doch ich will bald zum Punkt kommen, oder besser: zur Magie. Ich füge einfach zwei Erfahrungsberichte hinzu, die du dir gerne anschauen kannst.
Morgens um acht Uhr begann ich meine Schicht in der Küche des einzigen Restaurants in Mammoth Hot Springs im Yellowstone Nationalpark. Wieder wartete eine Menge Geschirr auf mich, die gewaschen werden wollte. Doch liess ich mir dadurch meine gute Laune nicht verderben.
„Guten Morgen, Mike“, grinste ich den Küchenchef an, als ich ihn hinter dem Grill hervortreten sah.
„Guten Morgen, Nando.“
Mike sprach meinen Namen mit seinem für mich drollig klingenden texanischen Dialekt. Ich liebte es, wie er meinen Namen aussprach.
„Heute ist der Tag des Präsidenten, hast du das gewusst?“, fragte er mich.
„Der Tag des Präsidenten? Welches Präsidenten?“
Es konnte ja irgendein Präsident sein, immerhin gibt es bestimmt mehr Präsidenten auf der Welt als Büffel im Park: Vereinspräsidenten, Verwaltungsratspräsidenten, Staatspräsidenten, Verbandspräsidenten.
Mike schaute mich belustigt an.
„Der Tag des Präsidenten, verstehst du? Habt ihr in der Schweiz keinen Präsidenten?“
„Na klar haben wir den, jedes Jahr einen anderen.“
„Wie bitte?“, rief Mike erstaunt. „Ihr Schweizer wählt jedes Jahr einen neuen Präsidenten?“
„Nein“, meinte ich mit einem schelmischen Lächeln, „wir wählen überhaupt keinen Präsidenten.“
„Ja, was denn nun? Ach, lass mich doch in Ruhe mit euren Präsidenten! Bill Clinton wird heute zu uns kommen, das ist das einzige, was wir wissen müssen.“
Kopfschüttelnd über die seltsamen Schweizer ging Mike wieder hinter seinen Grill, während ich rüber zur Geschirrwaschmaschine schritt.
Ich hatte die Morgen-und-Abend-Schicht. Ich hasste sie. Morgens früh aufstehen, um das Geschirr des Frühstücks abzuwaschen und abends bis spät in die Nacht das Geschirr des Diners in die Maschine stellen. Dafür hatte ich eine lange Mittagspause, mit der ich ohnehin nichts anfangen konnte. Doch heute freute ich mich. Präsident Clinton würde bei uns speisen, das gab es nicht alle Tage. Das Servicepersonal pendelte schon ganz aufgeregt zwischen Küche und Speisesaal umher. Gerade erschien Jennifer.
„Er kommt rein, der Präsident kommt rein!“, rief sie mir zu, als sie einen Stapel Teller vor mir auftürmte. Ich schaute sie verdutzt an. Wieso zum Geier sollte der amerikanische Präsident bei uns in der Küche vorbeischauen? Jennifer war längst wieder in den Speisesaal getigert.
Er kommt rein, der Präsident kommt rein! Jennifers Worte drehten sich in meinem Kopf. Ich schaute an mir runter. Über der üblichen Uniform des Tellerwaschers trug ich eine wasserfeste Schürze. Das störte mich. Denn an der Uniform war mein Namensschild festgesteckt. 'Nando, Switzerland' war mit grossen Buchstaben drauf geschrieben. Clinton würde wohl grosse Augen machen, wenn er in der Küche dieses abgelegenen Restaurants einen Angestellten aus der kleinen Schweiz erspähen würde. Vielleicht würde er mit mir sogar einige Worte sprechen! Mein Puls jagte, die Nervosität des Servicepersonals hatte von mir Beschlag genommen. Doch nein, Clinton würde gar nicht bemerken, dass ich aus der Schweiz kam; die Plastikschürze verdeckte das Namensschild. Ich zog den linken Rand der Schürze zurück und klemmte ihn unter das Namensschild. Es klappte, mein Name war jetzt für alle gut sichtbar. Nun würde die linke Seite meiner Uniform durch das spritzende Wasser des Abwaschs etwas nass werden, was soll's! Clinton sollte sehen, dass im grössten US-Nationalpark ein Schweizer die Teller wusch.
Neun Uhr abends. Der Präsident hatte sich noch nicht in der Küche blicken lassen, jedoch war ich dem schmutzigen Geschirr Herr geworden. Alles war sauber. Wenigstens für den Moment. Dies würde sich rasch wieder ändern. Ich nutzte den Moment, liess mir einen Becher heisse Schokolade aus dem Automaten raus und verliess die Küche durch den Hinterausgang. Einige Meter vor mir stand ein uniformierter Mann. Etwas weiter rechts erspähte ich durch die eindunkelnde Nacht eine Parkrangerin hoch zu Pferd. Weiter drüben stand ein weiterer Uniformierter. Das ganze Gebäude schien vom Sicherheitspersonal umstellt zu sein. Ich trank meine Schokolade, die meinen Magen wohlig warm stimmte, grinste die Uniformierten an und kehrte an meinen Arbeitsplatz zurück. Bereits türmten sich die schmutzigen Pfannen und Schüsseln wieder. Immerhin konnte ich mich jetzt sicher fühlen. Niemand würde mir mein schmutziges Geschirr klauen.
Nachts um halb zwei Uhr. Der Präsident war nicht in die Küche gekommen. Ich liess mir meine Enttäuschung nicht anmerken und schrubbte den Boden weiter. Unzählige Male war die Schürze vor das verflixte Namensschild gerutscht. Ebenso oft hatte ich sie wieder zurückgeklemmt. Um 23 Uhr hatte ich es schliesslich aufgegeben. Clinton würde nicht mehr kommen.
„Er kommt rein, der Präsident kommt rein“, hatte Jennifer gerufen. Natürlich kommt er ins Restaurant, nicht in die Küche. Was sollte der amerikanische Präsident auch in der Küche eines Restaurants im Yellowstone Nationalpark suchen? Ich musste über meine Naivität lachen.
Mike, der Küchenchef, lag längst in seinem warmen Bett. Eric leitete die letzte Schicht des Tages. Kopfschüttelnd sah er mich an.
„Hey, Nando, was ist mit dir geschehen?“, fragte er mich. „Du bist ja ganz nass.“
Als ich morgens vor unser Wohnhaus trat, begrüsste mich einmal mehr ein herrlicher Tag. Die Sonne schien vom strahlend blauen Himmel hernieder. Die Luft war angenehm warm.
Heute war mein freier Tag. Für einmal wartete nicht stapelweise schmutziges Geschirr auf mich. So konnte ich den Julitag in vollen Zügen geniessen.
Doch als ich vor das Haus trat, das ich zusammen mit etwa 80 weiteren Angestellten des kleinen Touristennestes im Yellowstone-Nationalpark bewohnte, sah ich es. Das Problem. Manchmal war es keines, heute jedoch schon.
Ich warf einen Blick auf meine Schweizer Armbanduhr. Das Morgenbuffet der Mitarbeiterkantine schloss um neun Uhr. Ich hatte also noch zwanzig Minuten, eine Lösung für das Problem zu finden. So setzte ich mich auf die Bank, die direkt vor dem Haus stand.
Vor mir lag, direkt hinter einem geteerten Strässchen, das parallel zum Haus und zur Bank verlief, eine gepflegte Wiese. Darauf befanden sich rechts zwei Tische mit Bänken. Links überspannte ein Volleyballnetz den Rasen. Dazwischen führte ein schmaler Fussweg zum Eingang in die Mitarbeiterkantine und gleich daneben, einige Tritte erhöht, zum Hintereingang der Küche.

Juniper Dorm in Mammoth Hot Springs mit Sitzbank vor dem Haus. Auf der Wiese äsen oft Wapiti-Hirsche.
Dies war alles wenig interessant und wäre des Beobachtens unwürdig gewesen, wären da nicht die Wapiti-Hirsche, die auf ebendiesem Rasen ästen.
Ein Bulle erregte meine Aufmerksamkeit. Mit seinem mächtigen Geweih nahm er eine dominante Rolle auf dem Rasen ein. Unruhig tigerte er zwischen den Hirschkühen umher. Einige waren jung und hielten sich ängstlich an ihre Mütter. Andere schienen alt; ihr Fell war struppig und fleckig. Der Bulle hatte es wahrlich toll – eine ganze Herde von Kühen für sich ganz alleine!
Gespannt beobachtete ich die Tiere. Der Hirschbock schien sich für eine Kuh entschieden zu haben. Vorsichtig näherte er sich ihr von hinten und schnupperte an ihrem Spiegel, dem weissen Hinterteil der Kuh. Diese wendete sich vom mächtigen Bullen ab und äste genüsslich weiter. Mühsam umschritt der Bulle seine Angebetete, bis er ihren Spiegel wieder zu riechen bekam. So ging es eine Weile weiter, bis es der Kuh zu dumm wurde. Rasch schritt sie unter dem Volleyballnetz hindurch und liess sich das saftige Gras auf der anderen Seite des Netzes schmecken.
Der Bulle reckte seinen Kopf hoch und röhrte seinen Ärger und seine Enttäuschung laut in den morgendlichen Himmel. Die Kühe störte dies nicht im Geringsten. Gemütlich kauten sie ihr Gras und würdigten ihr einziges Männchen mit keinem Blick. Blöde stierte der Bulle das Netz an. Er senkte der Kopf und versuchte darunter hindurch zu schlüpfen. Doch sein Geweih – das ihm sonst so dienlich war, wenn es darum ging, seine Kühe gegen konkurrierende Hirschbullen zu verteidigen – wurde ihm diesmal zum Verhängnis. Es gab kein Durchkommen. Das Netz hing zu tief, oder sein Geweih ragte zu hoch in die Luft. Plötzlich schien er einen Einfall zu haben. Langsam trottete er um das Netz herum.
Ich lachte leise vor mich hin, als sich die Tür zur Kantine öffnete und Andrew erschien. Andrew war ein ängstlicher Junge, der erschrocken stehen blieb, als er die Hirsche sah. Er getraute sich kaum zu atmen, während ich mit mir selbst Wetten abschloss, wie lange es dauern würde, bis sich Andrew ein Herz fassen würde, sich zwischen den Hirschen hindurch zu schleichen. Tatsächlich dauerte es gut und gerne zehn Minuten, bis Andrew einen Fuss auf den Rasen setzte. Ganz langsam, Schritt für Schritt, wagte er sich in das Territorium der Hirsche, immer ängstlich um sich blickend. Da! Eine Hirschkuh war auf ihn aufmerksam geworden und sprang auf ihn zu. Erschrocken ergriff Andrew die Flucht, alle anderen Hirsche vergessend. Die Hirschkuh setzte Andrew eine Weile lang nach, dann trottete sie hocherhobenen Hauptes zurück.
„Hallo, Andrew“ begrüsste ich Andrew lachend, als er mich endlich erreicht hatte. „Die Hirsche sind wohl nicht gerade deine Freunde, was?“ Andrew warf mir einen vernichtenden Blick zu und verdrückte sich rasch ins Wohnhaus.
Als Nächstes erschien drüben bei der Kantine Eric, der Schichtleiter. Ohne zu zögern und ohne die Hirsche auch nur eines Blickes zu würdigen, stiefelte er lässig über den Rasen. Kein Hirsch belästigte ihn.
Von links hörte ich den Bullen mal wieder frustriert röhren. Er hatte sein Ziel noch immer nicht erreicht. Der arme Bulle tat mir langsam leid – so viele Gefährtinnen und doch so alleine.
Mein Magen knurrte beinahe ebenso laut, wie der Bulle röhrte. Ich erhob mich von der Sitzbank. Mein Problem war gelöst – gerade noch rechtzeitig: in zwei Minuten schloss das Morgenbuffet. Ohne auch nur einen Blick nach links oder rechts zu werfen, schritt ich cool über den Rasen.
Was machte die Magie im Yellowstone aus?
In jugendlichem Alter zum ersten Mal für längere Zeit von zu Hause fort, befreit von den Fesseln der Schule, befreit von den elterlichen Fesseln, bedeutet Freiheit. Und das im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, den USA: doppelte Freiheit.
Ich hatte keinerlei Erwartungen, wollte einfach spannende Erfahrungen machen.
Es gab unglaublich viel zu entdecken. Daumen raus, ab ins Auto und schon landete ich irgendwo, bei einem tiefen Wasserfall, einem versteinerten Baum, bei dampfenden Hotspots, spritzenden Geysiren. Oder ich machte mich zu Fuss auf in die Berge, stiess auf verstörte Wandersleute, die gerade von einem Schwarzbären überrascht worden waren, auf allerlei Wildtiere und noch mehr Ruhe. Zeit für mich, abseits des Touristenrummels unten im Dorf.
Umgeben von vielen anderen Yellowstonern war immer etwas los. Es entstanden neue Kontakte, spannende Gespräche, gemeinsame Ausflüge oder Tischtennispartien.
Selbst die Arbeit hielt immer neues bereit. Zuerst als Tellerwäscher, dann im Restaurant hinter dem Frühstücksbuffet und in der Küche beim Bereitstellen von Salats und Desserts und zum Schluss als Teamleiter dieser beiden Bereiche.

In der Küche des Restaurants in Mammoth Hot Springs bereitete ich Desserts und Salate zu (1996). Da ich auch das Morgenbuffet im Restaurant bediente, trug ich keine Küchenuniform, sondern die schickere Uniform des Servicepersonales.
Und dann war da dieses internationale Ambiente, das ich liebte.
Insgesamt: Freiheit, Vielfalt, wilde Natur, viel Neues.
Sind das die Bauteile einer magischen Zeit? Nicht ganz – du erfährst sie gleich.
Die Bauteile für eine magische Zeit
Welche Momente fühlen sich besonders magisch an? Die Kinder wissen es. Wenn wir Kinder beim Spielen beobachten, dann erleben wir pure Magie.
Im Artikel "Das Geheimnis hinter der Magie des Spielens (und des Lebens)" habe ich 9 Regler herauskristallisiert, die in Balance sein müssen, damit Magie entsteht. Erreichst du diese Balance, fühlt sich dein Leben voller Magie an – ohne in den Yellowstone reisen zu müssen. Lass mich die 9 Regler des Magie-Mischpults anhand meines Yellowstone-Abenteuers erklären.

Tun-Wollen-Balance
Ich habe mich aus freien Stücken für meinen Arbeitseinsatz im Yellowstone entschieden. Zwar war die Arbeit teilweise nicht so attraktiv, aber das Gesamtpaket stimmte. Ich arbeitete nicht für Geld, nicht um Karriere zu machen, nicht weil das besonders sinnvoll ist. Stattdessen wollte einfach eine spannende Lebenserfahrung machen. Ich tat, was ich tun wollte.
Ernst-Lockerheit-Balance
Die Vorgesetzten verlangten seriöse Arbeit von mir. Das war der Ernst.
Die Stimmung war aber locker, alle duzten einander, oft schäkerten wir, egal ob bei der Arbeit oder in der Freizeit. Wir versuchten so viele Tabletts mit Plastikbechern aufeinanderzutürmen wie möglich und diesen Turm vom Abwasch in die Kantine zu balancieren. Wir feuerten uns gegenseitig an und feierten, wenn der ganze Turm mit wildem Geschepper zu Boden fiel.
Die Lockerheit war da, denn wir spielten oft wie die Kinder.
Kognition-Gefühle-Balance
Ich nahm im Yellowstone über meine Sinne wahr. Kognitiv. Ich sah die wundervolle Natur, ich roch den Schwefel der heissen Quellen, hörte das Röhren der Hirsche.
Gleichzeitig verspürte ich viele Gefühle. Ich sog die Freiheit über meine Gefühle auf und war glücklich.
Die Kognition und die Gefühle waren in Balance.
Realität-Fantasie-Balance
Obwohl vieles im Yellowstone-Nationalpark fantastisch erscheint, war alles real. Die wilden Tiere, die geothermischen Objekte und gar der amerikanische Präsident, der in unserem Restaurant speiste.
Trotzdem regte die Umgebung die Fantasie an. Beim nächtlichen Spaziergang auf den Hügel stellte ich mir einen Puma vor, der mich vom nächsten Baum herab beobachtete. Am Ufer der Biber-Teiche sitzend, malte ich mir aus, wie ein Grizzlybär auftaucht, um am Wasser seinen Durst zu stillen. In der Küche stellte ich mir vor, wie Bill Clinton in die Küche kommt und einige Worte mit mir spricht.
Das Unbekannte aktiviert die Fantasie.

Hot Spots im Yellowstone-Nationalpark.
Kontrolle-Vertrauen-Balance
Die Kontrolle war mit dem Vertrauen in Balance. Ich arbeitete kontrolliert, wusch Geschirr, bereitete Melonenschnitze für das Frühstück und Salatteller für das Abendessen vor. Ich wusste einigermassen, wo ich war, wenn ich in die Hügel ging, kontrollierte meine Schritte.
Gleichzeitig vertraute ich, dass ich dem gewachsen war, was ich in der Küche als Nächstes lernte. Ich vertraute, dass mich kein Grizzly zum Mittagessen vernaschte und vertraute, dass mich ein Auto zurückfuhr, wenn ich bis spätabends irgendwo im Park unterwegs war. Und ich vertraute, dass ich irgendwie wieder nach New York finden werde, von wo aus mein Rückflug startete.
Und das wichtigste: Ich vertraute ins Leben, vertraute darauf, dass ich in der Fremde eine gute Zeit verbringen würde.
Bewusstsein-Unterbewusstsein-Balance
Beim Spielen ist sowohl das Bewusstsein wie auch das Unterbewusstsein aktiviert. Genauso war es im Yellowstone.
Das Bewusstsein ist ohnehin immer aktiviert. Vielfach bleibt das Unterbewusstsein auf der Strecke.
Ich hörte damals stark auf meine innere Stimme. Nur schon, dass ich mich überhaupt auf den Weg in die USA gemacht habe – ich hätte den Grund nicht benennen können. Eine innere Stimme lud mich dazu ein.
Aber auch bei der Gestaltung hörte ich auf mein Unterbewusstsein. Was ich tat, fühlte sich richtig an. Bewusstsein und Unterbewusstsein arbeiteten Hand in Hand.

Blick von den südlichen Hügeln auf Mammoth Hot Springs.
Bekannt-Unbekannt-Balance
Genauso reichte das Bekannte dem Unbekannten die Hand. Fliegen war für mich bekannt, Greyhound-Fahren nicht. Teil eines strukturierten Arbeitsprozesses sein war bekannt, in einer Gastronomieküche arbeiten unbekannt. Wandern war bekannt, der Umgang mit Wildtieren unbekannt.
Anderes war zunächst unbekannt, wurde dann aber bekannt und liess dadurch wieder Raum für neues Unbekanntes. Tellerwaschen als einfache Tätigkeit war bald bekannt, dann kam das Frühstücksbuffet dazu, die Salate, Desserts und zuletzt die Führungsaufgabe.
Zuerst lernte ich Mammoth Hot Springs kennen, dann die nähere Umgebung und dann erweiterte ich meinen Aktionsradius immer mehr.
Stabilität-Flexibilität-Balance
Der Arbeitsplan gab mir einen festen Rahmen, verlieh meinem Aufenthalt Stabilität. Die freien Tage konnte ich flexibel, je nach Wetter und Bedürfnis gestalten.
Meine Vorgesetzten trugen mir Verantwortung auf, innerhalb derer ich flexibel auf die jeweilige Situation eingehen konnte.
Teilweise vereinbarten wir Wanderungen an bestimmten Orten. Ich musste kreativ einen Weg finden, wie ich ohne eigenes Auto und ohne ÖV dahin kam, das erforderte grosse Flexibilität.

Bisons am frühen Morgen im Hayden Valley, Yellowstone-Nationalpark.
Sicherheit-Unsicherheit-Balance
Mein Yellowstone-Abenteuer gab mir Gelegenheit, die Sicherheit und Unsicherheit genau zu dosieren. Ich konnte so viel Unsicherheit zulassen, wie ich wollte. Unsicherheit ist wichtig, sie verleiht einem Spiel die Würze.
Das tat ich, indem ich mehr oder weniger Unbekanntes in mein Leben holte. Das Unbekannte führte zu Unsicherheit, das Bekannte zu Sicherheit.
Fühlte sich eine Tätigkeit in der Küche zu unsicher an, fragte ich jemanden. Kannte ich einen Prozess nicht, zum Beispiel wie ich postlagernd Post beziehen kann, liess ich mir helfen.
Kannte ich die nähere Umgebung, erhöhte ich die Unsicherheit, indem ich weiter in den Süden vorstiess oder mich auf einen bislang Wanderweg begab, den ich bislang noch nicht begangen hatte.
Fazit: So ergibt sich Magie
Beim Spielen ergibt sich die Magie ganz von allein. Du brauchst nicht daran zu denken, die Unsicherheit oder die Lockerheit zu erhöhen.
Auch im Yellowstone war das so. Die Magie hat sich von allein ergeben.
Teilweise war das Glück. Glück, mit tollen Menschen arbeiten zu dürfen. Niemanden um mich zu haben, der mir meinen Aufenthalt im Yellowstone zur Hölle machte. Vorgesetzte zu haben, die mir vertrauten und mir immer dann mehr Verantwortung auftrugen, als sich Routine einschlich. All das hat zur Magie beigetragen.
Teilweise war es auch die unbeschwerte Haltung der Jugend, die mir half. Ich vertraute dem Leben, kümmerte mich wenig darum, ob ich scheitern könnte, plante kaum.
Meine Zeit im Yellowstone boten mir Freiheit, Vielfalt, wilde Natur, viel Neues. Doch auch anderswo erlebte ich Magie. Als ich das Buch "Spiel dein Leben – über die Leichtigkeit des Lebens" schrieb, war das genauso pure Magie. Und das in einer ganz anderen Umgebung, Zuhause vor dem Laptop sitzend.
Dank den neun Reglern des Magie-Mischpults kannst du dir ganz bewusst mehr Magie in dein Leben holen, indem du analysierst, welche Regler nicht in Balance sind und diese dann in die entsprechende Richtung verschiebst.
Hast du auch eine magische Zeit erlebt? Ich freue mich auf deinen Kommentar.

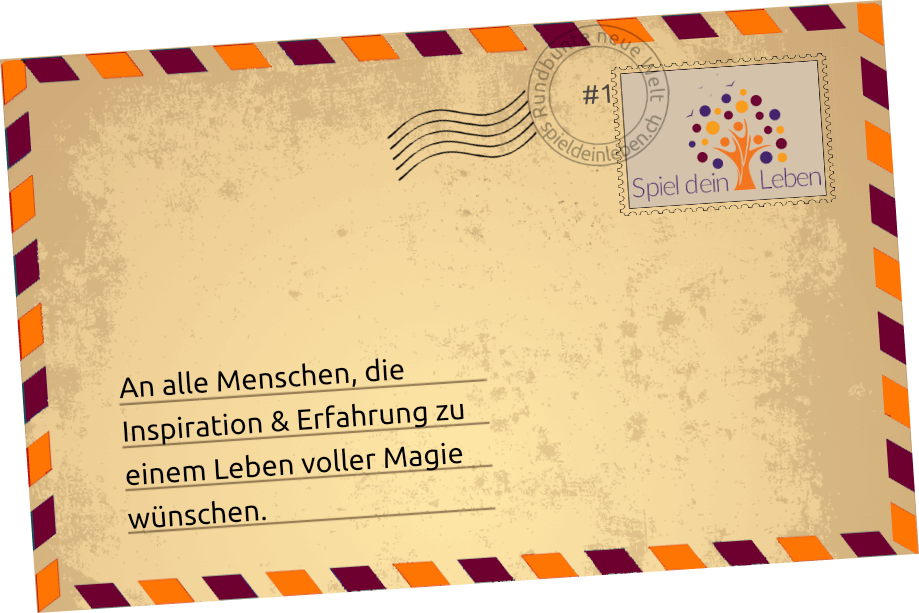
Min. Lesezeit